
„Wir müssen umdenken“

Veränderungen setzen Entscheidungen voraus. Doch was wir heute entscheiden, wirkt oft mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Wie sollen wir da die Weichen für eine Zukunft stellen, die wir noch gar nicht kennen?
Unsere Zukunft kennen wir natürlich nicht, aber Ziele können wir definieren. In erster Linie müssen wir entscheiden, was wir wirklich wollen. Für viele ist es der durchaus erstrebenswerte Wunsch, seinen Kindern und Enkeln die Erde in einem besseren Zustand zu überlassen, als sie sie selbst vorgefunden haben. Dazu gehört der Planet selbst, aber auch unser gesellschaftliches Miteinander. Schauen Sie: Wenn man sich etwa den ökologischen Fußabdruck der Menschheit anschaut, die Veränderungen durch die Agrikultur, durch Urbanisierung, durch große Bauten wie Staudämme, die die Topologie der Natur verändern, dann sind wir schon in einigen Punkten zu Gestaltern dieses Planeten geworden …

… was man sogar auf nächtlichen Satellitenaufnahmen der Erde sehen kann, die immer größere Lichtermeere zeigen.
Unser Planet leuchtet in der Tat immer heller. Ich selber denke da an meine Kindheit, die ich in Indien verbrachte – Indien war damals dunkel und galt als rückständig. Heute leuchtet es flächendeckend. Man sieht am elek-trischen Licht, das sich in kürzester Zeit über diesen Planeten ausgebreitet hat, zwei Sachen: Das eine ist die Diffusion des Fortschritts. Früher waren die hoch technisierten Nationen Inseln, inzwischen ist der gesamte Planet illuminert. Das andere ist natürlich der wachsende Ressourcen- und Energiekonsum, der indirekt über das Licht abgebildet wird. Das eine, das Ausbreiten des technischen Fortschritts, ist eine gute Sache und das andere eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren meistern müssen. Unsere begrenzten Ressourcen reichen nicht aus, wenn wir weiterhin business as usual betreiben. Wir müssen umdenken, neue Wege gehen, damit alle Menschen nachhaltig vom Fortschritt profitieren können!

Die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts ist gegenwärtig geradezu atemberaubend. Für viele zu schnell. Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und die dahintersteckenden Algorithmen sind für Normalbürger kryptisch wie Quantenphysik. Macht uns diese Unwissenheit vielleicht zu leichtsinnig, geben wir zu viel digitale Macht aus den Händen?
Die Gefahr besteht. Viele von uns umgeben sich mit Apparaten wie Amazon Echo oder Google Home und wissen nicht wirklich, wie diese Techniken arbeiten. Wir nutzen soziale Netzwerke, doch die Algorithmen, die diese Netze strukturieren und ausmachen, durchschaut kaum jemand. Es gibt digitale neuronale Netze, die bereits angewendet werden, obwohl selbst Fachleute nicht verstehen, wie diese komplexen Systeme wirklich funktionieren. Momentan sind wir bei neuen Technologien wie Kinder, die ein Geschenk auspacken und sofort loslegen. Uns fehlt eine Art Betriebsanleitung des Fortschritts.

2010 sagte Google-Chef Eric Schmidt einen denkwürdigen Satz: „Wir wissen, wo du bist, wo du warst, und wir wissen mehr oder weniger, was du denkst.“ Klingt beunruhigend.
Daten sammelnde Plattformen wie Google oder Facebook sind inzwischen so groß, dass sie systemrelevant werden. Ein Netzwerk mit einem derartig großen Einfluss auf das Miteinander in einer Gesellschaft sollte seine Algorithmen offenlegen. Die digitale Kultur bietet uns eine neue Art des Miteinanders, die wir vor Jahren noch nicht kannten, deren Regeln wir erst lernen und deren Chancen wir aktiv angehen müssen. Es wäre sehr bedauerlich, wenn uns die Digitalisierung um die Ohren fliegt, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben.

Wie gut wurden denn die Hausaufgaben im Bereich Automobil gemacht?
Die Hersteller und Zulieferer haben die Fahrzeuge in den vergangenen Dekaden Stück für Stück optimiert, sie sicherer, effizienter gemacht. Aber die große Chance, die wir haben, liegt darin, breiter zu denken. Also nicht im Sinne der Optimierung eines individuellen Autos, sondern im Sinne einer Optimierung neuer Mobilitätskonzepte. Den Bedarf dazu sieht man in fast jeder Stadt ganz klar, wo in den vorbeifahrenden Autos meistens nur eine einzige Person sitzt. Wenn ein Marsmensch sich das anschauen würde, würde er denken: Homo sapiens muss schon irgendwie sonderbar sein – der bewegt anderthalb Tonnen Stahl, um 60 oder 70 Kilo Mensch hin und her zu befördern …

… und sie dann die meiste Zeit des Tages unbenutzt abzustellen.
Genau. Unmengen an Autos parken am Straßenrand und kosten Raum – das ist nicht unbedingt etwas, das uns Menschen nützt. Im Vergleich dazu: Wenn Sie heute Carsharing-Konzepte betrachten, ersetzt ein einziges Carsharing-Auto etwa 20 individuelle Fahrzeuge, was eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern ausmacht. Platz, der auch genutzt werden könnte, um den Verkehrsfluss zu erhöhen. Der technische Fortschritt setzt viel neues Potenzial frei – aber wir schöpfen es nicht vollkommen aus, wenn wir in den alten Kategorien weiterdenken. Manchmal muss man springen, hinein in eine neue Sicht.

Können Erlasse, Verordnungen und Gesetze eine Absprunghilfe sein?
Bedingt. Ein positives Beispiel ist der Katalysator für Autoabgase, der 1968 aufgrund einer staatlichen Verordnung in Kalifornien eingeführt wurde und heute weltweiter Standard ist. Aber wie gesagt: Das hat das einzelne Auto besser gemacht, aber nicht die Verkehrssituation, die Mobilität insgesamt.

Ein Paradigmenwechsel ist nicht nur nötig – er ist auch möglich
Ranga Yogeshwar

Wenn Gesetze nicht reichen, Potenziale auszuschöpfen und uns auf die Sprünge zu helfen, was oder wer dann?
Wenn man sich etwa die Haltung junger Menschen in Städten anschaut, die inzwischen vielfach auf den Besitz eines eigenen Autos verzichten und eher auf alternative Mobilitätskonzepte wie Carsharing vertrauen, merkt man, dass es weniger die Gesetze waren, sondern die neuen Potenziale, im konkreten Fall etwa die Digitalisierung und damit verbunden die Möglichkeit, diese Art von neuer Mobilität zu etablieren. Verordnungen sind auch wichtig, aber Kreativität entspringt eher aus der Erkenntnis, bestimmte Probleme erneut zu reflektieren. Wenn man sich das bei der Mobilität genauer anschaut, zeigt sich ein erster Umdenkprozess: Es geht nicht mehr unbedingt darum, ein Auto zu besitzen – wofür es im Übrigen auch keinen natürlichen Trieb gibt. Es geht um die effiziente Autonutzung. Besonders junge Menschen erkennen das. In den letzten Jahren ist die Zahl junger Autokäufer gerade in urbanen Ballungsräumen rückläufig. Und es gibt Anzeichen, dass auch die Autoindustrie das erkennt und neue Konzepte forciert.

Wir stehen also vor einem generellen Paradigmenwechsel?
Dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur nötig – er ist auch möglich. Letzteres ist besonders wichtig, denn manchmal wünschen wir uns eine andere Zukunft, aber wir sehen nicht, wie wir das umsetzen können. Und da zeigen die Innovationen der letzten Jahre und auch Jahrzehnte neue Wege auf.

Auch außerhalb der Mobilität?
Es gibt in jedem Bereich, zumindest soweit ich es übersehe, vielversprechende Ansätze. Nehmen wir mal die Energieerzeugung: Wir haben de facto kein Energieproblem, die Sonne strahlt – wenn sie scheint – mit einer Intensität von etwa einem Kilowatt pro Quadratmeter. 1.000 Watt, das ist eine Menge. Wenn man sich heute in der Photovoltaik den Wirkungsgrad von Solarkollektoren anschaut, dann ist er – nach den sehr wenigen Prozenten noch vor einigen Jahren – inzwischen zweistellig geworden, sodass beträchtliche Teile der Sonnenenergie genutzt werden können. Der nächste Schritt wird sein, diese Energie effizient zu speichern für jene Momente, in denen die Sonne nicht scheint beziehungsweise um die Volatilität des Stromverbrauchs auszugleichen. Power-to-Gas oder auch mit Strom produzierte Synfuels sind da hochinteressante Technologien.

Ein weiteres Beispiel bitte.
Wir diskutieren das Insektensterben und daran gekoppelt den Einsatz der Herbizide und Insektizide in der Landwirtschaft. Wir alle merken, dass wir zunehmend ein Problem haben, weil wir Unmengen an Giften ausbringen, doch viele sehen keine wirkliche Alternative. Jedem, der sich ein wenig mit Landwirtschaft auseinandersetzt, ist klar, dass wir momentan ganz ohne solche Mittel kaum auskommen können. Aber jetzt kommt plötzlich künstliche Intelligenz, jetzt kommt plötzlich Robotik, es kommen autonome Fahrzeuge, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren auf den Feldern autonom agierende Roboter sehen, die Unkraut jäten. Diese neue Technologie könnte die Chemie in der Landwirtschaft ersetzen, ähnlich wie Photovoltaik einmal die Kohle ersetzen wird.

Sind solche um die Ecke gedachten Ideen der Schlüssel zum Erfolg?
Auf jeden Fall! Aber genau dieses Denken über erlernte Muster hinaus ist so schwierig. Das zeigt auch ein Blick in die Geschichte, denn wir sind nicht die erste Generation, die sich eine Zukunft erträumt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts träumte man von Eisenbahnen, Dampfschiffen und von Zeppelinen, die durch die Städte fliegen. Was in gewisser Weise zeigt, dass jede Generation, wenn sie Zukunftsträume hat, in ihren eigenen Kategorien verhaftet ist. Das heißt, wir denken unsere Welt und extrapolieren – wir sind kaum in der Lage, Sprünge nachzuvollziehen oder gar vorher zu antizipieren. Noch vor zehn Jahren hat sich niemand die umwälzenden Veränderungen vorstellen können, die das Smartphone mit sich gebracht hat. Das Spannende ist, das wir bei diesen technischen Optionen immer auch gesellschaftliche, vielleicht ethische Grundsätze überprüfen müssen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht Visionen verwirklichen, die rein technologiegetrieben sind. Ich glaube eher an das, was ich reflektierten Fortschritt nenne, das heißt, sich mal wirklich Gedanken zu machen über die Ziele und dann im nächsten Schritt zu überlegen, welche Technologie können wir dafür nutzen.
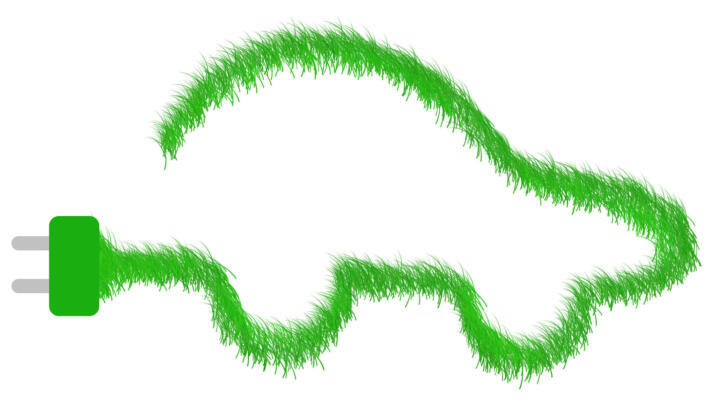
Wie nachhaltig kann oder muss ein solch reflektierter Fortschritt sein?
Wer Nachhaltigkeit propagiert im Sinne eines Verzichts im Vergleich zum heutigen Status quo, wird scheitern. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt; es gab immer wieder viele Aktivisten, engagierte Menschen, die gesagt haben, wir brauchen weniger – und nicht begriffen haben, dass das kein Weg ist, der zum Erfolg führt.

Und was wäre ein Weg?
Wir merken schon in einigen Bereichen ein gewisses Umdenken. Es ist heute ja kein Problem, synthetisch-industriell Essen in großem Maßstab zu produzieren, doch interessanterweise entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, mal wieder selber zu kochen und regional einzukaufen. Das sind im Grunde genommen erste Zeichen einer mündigen Entscheidung pro Nachhaltigkeit. Aber was wir alle gemeinsam tun müssen, ist, uns in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund des enormen Wandels gemeinsam als Gesellschaft über die Ziele klar zu werden. Wo wollen wir wirklich hin?

In solchen Debatten über die Zukunft ist immer wieder die Rede von der nötigen „großen Transformation“. Was braucht es für eine zukunftsfähige Transformation seitens Industrie und Wirtschaft – bei uns und in der Welt?
Es braucht möglicherweise diese Vision, sich eine Welt in 10 oder 15 Jahren vorzustellen, um zu merken, dass sich viel mehr ändert als nur ein Detail in einem Fertigungsprozess oder in einer Industrie. Wir sind vielleicht in einigen Bereichen erstmals in der Lage, einen Großteil der Arbeit an Maschinen zu delegieren. Das verschafft uns einerseits mehr Zeit, um uns um andere Dinge des Lebens zu kümmern, die für unsere Gesellschaft wichtig sind, wie beispielweise Bildung und Kultur. Andererseits müssen wir über die Verteilung von Einkommen und damit von Nahrungsmitteln und Konsumgütern nachdenken, denn eine Gesellschaft, die irgendwann eine Minderheit zu Gewinnern und den Rest zu Verlierern macht, ist nicht stabil. Das wird nicht funktionieren. Da gibt es ja auch schon erste Diskussionsansätze wie das bedingungslose Grundeinkommen …

… das von vielen abgelehnt wird. Schließlich definiert sich ein Großteil der Menschheit über die Arbeit.
Richtig. Und genau dieses Selbstverständnis zu revidieren, die alten Kategorien unserer Väter zu verlassen, wirklich aufzubrechen und neue Kategorien zu setzen, das ist leichter gesagt als getan. Zumal dieses Umdenken über Grenzen hinweg erfolgen muss. Denn in unserem globalen Weltwirtschaftssystem braucht es eine gewisse Synchronizität der Erkenntnis. Eine Trägheit in Bezug auf Veränderungen offenbart sich aber gerade auch in Nationen, die sehr erfolgreich sind – wie zum Beispiel auch bei uns in Deutschland. Uns geht es momentan wirtschaftlich gut, und das führt dazu, dass viele blockiert sind und sagen, wir machen weiter wie bisher, denn alles ist gut. Viele begreifen nicht, dass wir wirklich mitten in einem tiefer gehenden Wandel stecken, den wir mitgehen müssen, um nicht abgehängt zu werden.

Deutschland und die Welt müssen also eingefahrene Wege verlassen, die „Nächste Ausfahrt Zukunft“ nehmen – um Ihren Buchtitel aufzugreifen. Was passiert, wenn wir die Ausfahrt verpassen?
Die historisch belegbare Tatsache, dass große epochale Veränderungen oft einhergingen mit Krisen, mit Kriegen, mit sehr viel Leid, sollte uns allen ein Alarmzeichen sein. Meine Hoffnung ist, dass wir diese Klippe diesmal umschiffen können. Doch dafür müssen wir alle aktiv zusammenarbeiten und diese Zukunft gestalten. Wer denkt, dass irgendein Unternehmen oder ein Land die Zukunft aller gestalten kann, der irrt. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alle übernehmen müssen. Was mich optimistisch stimmt, sind die Chancen, Freiheiten und Möglichkeiten, die der technische Fortschritt unterm Strich mit sich bringt – so verunsichernd er an der einen oder anderen Stelle auch erscheinen mag. Allerdings ist in einem Fortschritt, der so immens schnell ist und dessen Konsequenzen in so vielen Lebensbereichen sichtbar werden, die Notwendigkeit der philosophischen, der gesellschaftlichen, der ethischen Reflexion unabdingbar.
Der Befragte: Ranga Yogeshwar

Der Begriff Muttersprache ist für Ranga Yogeshwar eher ungeeignet. Seine Mutter sprach zu Kinderzeiten Luxemburgisch mit ihm, der Vater Englisch und Tamil, die Lehrerin Hindi, die Haushälterin Kannada und der Gärtner Malayalam. Später kamen noch Französisch und Deutsch dazu. Ebenso kniffelig ist für den Endfünfzi- ger die Frage nach seiner Nationalität zu beantworten. Fühlt er sich eher als Inder, Luxemburger oder doch als Deutscher? Er sei vor allem er selbst, lau- tet seine Antwort. Viel wichtiger ist dem studierten Physiker ohnehin die Frage, auf welchem „Betriebssystem“ er läuft: die Aufklärung und das deutsche Grundgesetz. Yogeshwar stellte sich 1986 nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl erstmals als Technik-Erklärer vor eine Kamera – damals war er mit seinem dunklen Teint ein echter Exot im deut- schen Fernsehen. Auch das hat sich gewandelt.


